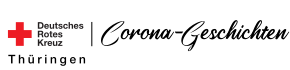Meine Zweijährige und ich landen im März 2020 in den ersten Tagen des Lockdowns auf der Corona-Station eines sächsischen Provinzkrankenhauses. Das Kind wirbelt die Betriebsabläufe durcheinander, und das Personal probt an uns den Ernstfall.
Corona-Verhör und Verhaftung
Das Kind krampft am ganzen Körper. Sein Köpfchen hängt schräg nach vorne, Spucke rinnt aus dem halboffenen Mund. Ich halte es mit ausgestreckten Armen vor mir und wiederhole immer lauter seinen Namen. Doch meine Tochter reagiert nicht. Die Augen sind auf, aber ich finde keinen Blickkontakt. Mein Mann wählt die 112. Ich drücke das bebende Bündelchen an mich und sinke auf einen Küchenstuhl. Durch die offene Tür höre ich, wie mein Mann der Rettungsstelle die Symptome schildert. Meine Schwiegermutter drückt dem Kind einen nassen Waschlappen auf die Stirn. Dann läuft sie hinaus, um dem Rettungswagen den Weg zu weisen. Die Tür klappt, für einen Moment wird die Küche leer mit Stille.
Doch schon höre ich in der Ferne eine Sirene. Und tatsächlich wird sie lauter, kommt den Waldweg herauf, zu einem abgelegenen Haus im sächsischen Nirgendwo. „Wahnsinn, in was für einem Land wir leben, wie die Dinge funktionieren“, denke ich kurz. Schon hallen schnelle Schritte im Flur, schon öffnet sich die Küchentür, schon stehen zwei Männer mit knallroten Westen und weißen Hemden vor uns.
Einer der Sanitäter kniet sich herunter. Das Kind hängt matt in meinem Arm, hat aber aufgehört zu zittern. Und für den großen Mann in der roten Weste hat es sogar ein kleines Lächeln. Mein Mann und ich erzählen, dass unsere Tochter seit Tagen hustet und fiebert; jetzt das Krampfen und der starre Blick. „Wahrscheinlich ein Fieberkrampf. Das sieht gefährlicher aus, als es ist“, beruhigt der Sanitäter.
Ob außer dem Kind noch jemand von uns Fieber und Husten hat, will er dann wissen. Ich sage, dass ich die letzte Woche mit einer heftigen Erkältung flachgelegen habe, und schon sind wir mitten im Corona-Verhör: „Waren Sie in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet? Hatten sie Kontakt zu einer Person mit Covid-19?“ – Wir schütteln zu beidem den Kopf. – „Sie wohnen alle hier im Haus?“ – „Nein, nur die Oma. Wir zwei und das Kind sind eigentlich aus Dresden“, geben mein Mann und ich kleinlaut zu. – Wie lange wir schon hier sind? – „Seit einer guten Woche; als alles zumachte, haben wir beschlossen für eine Zeit aufs Land zu fahren.“ – Der Sanitäter runzelt die Stirn, kommentiert unser Fehlverhalten aber nicht. „Das Kind kommt jetzt ins Krankenhaus. Und Sie nehmen wir auch mit“, sagt er dann. – Das Corona-Verhör wird zur Corona-Verhaftung.
Mein Mann trägt unsere Tochter nach draußen. Ich schnappe Telefon und Zahnbürste und laufe dann hinterher. Das Kind ist bereits im Fahrgastraum auf einer Liege festgeschnallt. Ich setze mich daneben und nehme seine Hand. Wir verlassen die Einöde und rasen auf der kurvenreiche Landstraße Richtung Norden. Die Kurven schaukeln meine Tochter in Schlaf. In der Ferne heult immer wieder eine Sirene. „Komisch, so viele Notfälle heute“, denke ich. Dann erst merke ich, dass ich die ganze Zeit die Sirene des Krankenwagens höre, in dem ich sitze. Sie ist seltsam leise – wir fahren den Schallwellen mit hohem Tempo davon. Die wenigen Autos, die vor uns auftauchen, ducken sich brav an den Straßenrand bis wir vorbei sind. Ich frage mich, ob Tatütata und Tempo in einem vernünftigen Verhältnis zur Gefährdungslage stehen. Doch da erreichen wir schon wohlbehalten das Klinikum der nächstgelegenen Kleinstadt.
Untersuchungshaft und Katastrophenübung
Wir biegen im Schritttempo in den Gebäudekomplex ein und halten an einem eingeschossigen Flachbau. Dort werden wir bereits erwartet: Eine Schwester mit Mundschutz öffnet meiner Tochter und mir die Tür, begrüßt uns mit gebührendem Abstand und führt uns ein Stück den Flur hinunter in unser Zimmer. Mit dem schlaftrunkenen Kind im Arm setze ich mich auf den einzigen Stuhl.
Nach ein paar Minuten bekommen wir Besuch vom Stationsarzt. Meine Tochter ist mit einem Mal hellwach, schreit schrill und wedelt mit den Ärmchen. Dann bricht sie in Tränen aus. Sie hat Angst vor dem Mann in der komischen Montur: Er trägt ein grünliches knöchellanges „Kleid“ und orange Gummihandschuhe. Die Haare sind unter einer voluminösen Haube versteckt; Mund und Nase mit einer Maske bedeckt. Der Mann guckt uns durch eine „Taucherbrille“ an. Um die Stirn hat er ein durchsichtiges Visier geschnallt, das bis zur Brust hinunter reicht.
Er wiederholt die Fragen der Sanitäter: Fieber? Husten? – Ich nicke. – Kontakt zu einem Corona-Infizierten? Aufenthalt in einem Corona-Riskiogebiet? – Nein. – Der Arzt schaut in meine Patientenakte: „Naja, aber aus Dresden kommen Sie, da ist doch schon ein bisschen mehr los als bei uns.“ – Dresden scheint für das hiesige Empfinden also so eine Art Risikozone zu sein. – „Ich mache jetzt einen Abstrich und teste Sie auf das Virus. Dann haben wir morgen im Laufe des Tages Gewissheit.“
Der Arzt zieht ein etwa 20 cm langes Watte-Stäbchen aus einem Röhrchen: „Jetzt bitte den Mund aufmachen und einen großen Schluck Luft nehmen.“ Das Stäbchen stößt tief in meinen Rachen. Ich würge und huste. Tränen schießen mir in die Augen. Ruckartig drehe ich den Kopf weg. Doch das Stäbchen wandert bereits zurück ins Röhrchen. Meine Reaktion ist mir ein bisschen peinlich. – „Keine Sorge, ein gesunder körperlicher Abwehrreflex“, sagt der Arzt.
Lächelt er dabei? – Schwer zu sagen. Die Schutzbekleidung versteckt Gesichtszüge und Mimik. Wieviel ein Gesicht sonst doch erzählt: Ist mein Gegenüber freundlich, zum Scherzen aufgelegt? – Das Kind ist es jedenfalls nicht. Sein Weinen ist jetzt ein Brüllen. Ich erinnere den Arzt daran, dass wir doch eigentlich nicht meinet-, sondern meiner Tochter wegen hier sind. – Er wiegt bedenklich mit dem Kopf: Ein Kind muss von einem Kinderarzt untersucht werden. Doch als Corona-Verdachtsfälle dürfen wir unser Zimmer nicht verlassen. Ein Kollege aus der Kinderstation muss geholt und eingewiesen werden. – Der Arzt geht, das Kind beruhigt sich. Es ist mittlerweile recht munter, tappelt Richtung Ausgang, sagt „Auf, auf!“ und will das Tür-auf-Tür-zu-Spiel spielen, das es zur Zeit so erfreut. Ich erkläre, dass die Zimmertür zu bleiben muss und zeige die Tür zur Bad-Kabine. – Meine Tochter ist zufrieden.
Nach einer Weile ist wieder Bewegung vor unserem Zimmer: Die Tür öffnet sich einen Spalt, wird nochmals zugezogen, bleibt aber angelehnt. Ich spitze die Ohren und höre die Vorschriften zum Betreten von Corona-Zimmern: Vor jeder Tür steht Einweg-Schutzbekleidung bereit. – Kittel, Kopfbedeckung, Atemschutzmaske, Brille und Handschuhe. Alles wird jedesmal aufs Neue angelegt, beim Verlassen des Raumes in die Mülltonne an der Tür geworfen. Hinein zum Patienten darf jeweils nur eine Person, niemals mehrere gleichzeitig. Dann noch ein Rascheln, ein Kichern, die Tür schwingt auf, die Kinderärztin ist bei uns. „Wir müssen selber erst lernen, wie das hier alles geht,“ sagt sie. Dann steckt sie meiner schreienden Tochter ebenfalls ein Watte-Stäbchen in den Hals, horcht den kleinen Brustkorb ab und ordnet ein Röntgen der Lunge an.
Weil wir aus unserem Zimmer nicht raus dürfen, muss ein mobiles Röntgengerät her. Zwei Schwestern bringen die große Maschine und schon stößt das Hygiene-Reglement an seine Grenzen: Schwester eins weist Schwester zwei darauf hin, dass nur jeweils eine Person im Patientenzimmer zu sein habe. – „Wie soll das aber gehen?“, gibt Schwester zwei zurück: Eine müsse schließlich das Kind in Position bringen, die andere den eineinhalb Meter entfernten Auslöser betätigen. „Geht da jetzt die Welt unter, wenn ich im Raum bin und den Knopf drücke?“, setzt sie nach.
Ich versuche zu schlichten: Ob ich vielleicht mein Kind halten soll? – „Geht nicht, Sie haben keine Bleischürze. Und die unter unserer Schutzkleidung können wir Ihnen nicht geben, die wäre ja dann kontaminiert.“ – Schließlich einigen sich die Schwestern doch, das Bild gemeinsam zu machen; zumal man nun eh schon zu zweit im Zimmer sei. – Doch das nächste Problem bin ich: „Ohne Strahlenschutz können Sie überhaupt nicht hier im Raum sein“, sagt wieder Schwester eins.– „Sie dürfen aber wegen Corona auch nicht aus Ihrem Zimmer raus“, sagt Schwester zwei. – Wir gucken uns ratlos an. Dann fällt der Blick von Schwester eins auf die Bad-Kabine. „Sind Sie schwanger?“, fragt sie mich. Ich schüttle den Kopf und gehe in Deckung. – Ich fühle mich wie ein Übungspatient in einer Katastrophenübung, bei der vieles nicht eingespielt ist und vieles nicht nach Plan läuft.
Hafterleichterung und Entlassung
Als die Kinderärztin am nächsten Tag wieder zu uns ins Zimmer kommt, tut sie es – entgegen jeder Vorschrift – komplett unverhüllt. Sie strahlt: „Ich habe gute Nachrichten! Eben kam Ihr Testergebnis. Sie sind beide Corona-negativ.“ Die Blutwerte und Röntgenbilder meiner Tochter deuten auf eine leichte Lungenentzündung hin. Wir werden aus der Corona-Station entlassen und verbringen noch einen Tag auf der Kinderstation. Weiteren Patienten begegnen wir dort nicht. Andere Kinderstimmen sind nicht zu hören, die Flure sind gespenstisch leer. Und auch uns schickt man heim: Eine normale Lungenentzündung sei nichts, weswegen man im Krankenhaus sein müsse; schon gar nicht in dieser Zeit. Das Kind soll sich in Ruhe zu Hause auskurieren.
Ich packe unsere Habseligkeiten und verlasse mit meiner Tochter an der Hand das Gebäude. Mein Mann erwartet uns auf dem Parkplatz. Wir fahren durch menschenleere Straßen, das Städtchen liegt still wie im Dornröschen-Schlaf. Auf der Bundesstraße nach Hause begegnet uns kaum ein Auto. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Geht die Katastrophenübung in die Katastrophe über? – Vorerst sind wir frei, erleichtert und – zumindest was Corona angeht – gesund.
von Dr. Maria Magdalena Verburg